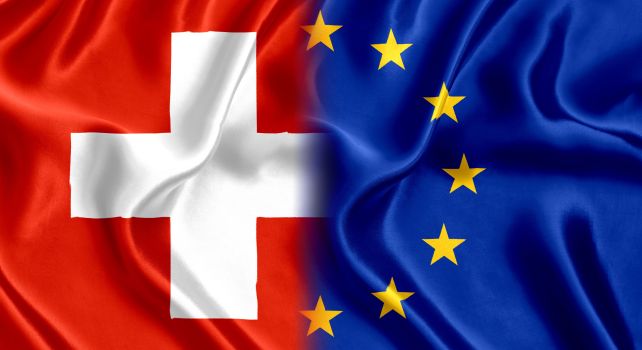«Es geht darum, was am besten für unser Land ist»
Die Basler Professorin Christa Tobler spricht sich für ein geregeltes Verhältnis mit der Europäischen Union aus. Sie ist davon überzeugt, dass die Bilateralen III die Volksrechte nicht derart einschränken, dass sie deswegen inakzeptabel würden.
Der Beitrag erschien erstmals in unserem Magazin Tribune. Kurt Tschan hat das Interview geführt.
Frau Professorin Tobler, die Schweiz hat ihre Beziehungen zur EU in bilateralen Verträgen und zahlreichen Abkommen geregelt. Wie haben diese Verträge die Schweiz verändert?
Bilaterale Verträge mit der EU werden seit den Fünfzigerjahren abgeschlossen. Etwa 20 von ihnen gelten als besonders wichtig. Die übrigen weit über hundert werden in der öffentlichen Diskussion kaum wahrgenommen. Vor allem die Wirtschaftsabkommen mit einer Annäherung an EU-Recht haben vieles vereinfacht und den wichtigen Zugang zum Binnenmarkt erst ermöglicht.
Gab es in den Fünfzigerjahren ein vergleichbares Misstrauen wie heute?
Überhaupt nicht. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), eine der Vorgängerorganisationen der heutigen EU, war bestrebt, weitere Kriege zu verhindern und Wohlstand zu schaffen, und zwar durch eine besonders starke Form des internationalen Rechts. Die Schweiz schloss sich diesem ehrgeizigen Projekt nicht an und half stattdessen, die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) zu gründen. Eine vereinfachte wirtschaftliche Zusammenarbeit war aber auch mit der EWG gewünscht. Mit ihr schloss die Schweiz Verträge, die etwa die Zugtarife oder den Handel mit Uhren und Käse betrafen.
Warum braucht es aus der Sicht des Bundesrates die Bilateralen III?
Das komplexe Netzwerk von Abkommen deckt gewisse Bereiche gut ab. Die Welt dreht sich aber weiter. Liechtenstein als Teil des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) hat vergleichbare Regeln wie der EU-Binnenmarkt. Andorra und Monaco haben jüngst neue Abkommen mit der EU abgeschlossen. Zum eigentlichen EU-Binnenmarkt kommt dadurch eine erweiterte Form mit jenen Ländern, die sich auch ohne EU-Mitgliedschaft beteiligen. Für all diese Länder braucht es homogene Regeln, damit der erweiterte Binnenmarkt zuverlässig funktioniert. Deshalb will die EU gewisse Abkommen mit der Schweiz modernisieren und institutionelle Fragen klären. Die Schweiz wiederum möchte neue Abkommen. Diese betreffen die Gesundheit, die Lebensmittelsicherheit und den Strom. Am Schluss geht es darum, in diesem Interessen-Mix einen guten Kompromiss zu finden.
Steht dabei die Übernahme von EU-Recht im Vordergrund?
Kommt diese Paketlösung zustande, handelt es sich bei den Wirtschaftsverträgen eindeutig um eine Annäherung der Schweiz ans EU-System und nicht umgekehrt. Wir assoziieren, beteiligen uns am EU-Binnenmarkt. Dieses System wurde nicht von uns erfunden und beruht nicht auf Schweizer Regeln. Wir übernehmen insofern gewisses EU-Recht in unsere Abkommen.
Werden die Bilateralen politisch missbraucht?
Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens wurde mit den Bilateralen III ein deutlich grösseres Abkommenspaket geschnürt. Je mehr Themen auf dem Tisch liegen, desto mehr Menschen werden sich finden, die gegen das eine oder andere etwas haben. So kann es passieren, dass das grosse Bild hinter Einzelinteressen verschwindet.
Einer Ihrer letzten Vorträge war mit «Dummheit aus einer rechtlichen Perspektive betrachten» überschrieben. Umschrieben Sie damit das Verhältnis Schweiz-EU?
Die offizielle Überschrift war «Dummheit vs. Recht und Gerechtigkeit», wie in einem Gerichtsfall im englischsprachigen Raum. Ich hielt diesen Vortrag für die Theologische Fakultät Basel im Rahmen ihrer Fakultätstagung zum Thema «Dummheit». In diesem Zusammenhang stellte ich das Argument zur Diskussion, der Bundesrat wolle mit den Bilateralen III «das Volk für dumm verkaufen». Ein Argument, das regelmässig von der SVP zu hören ist. Ich fragte nun, was hier mit Dummheit gemeint sei. Selbst finde ich: Unterschiedliche Meinungen zum Thema sind natürlich immer möglich. Die Diskussion muss jedoch faktenbasiert geführt werden. Gewisse Kreise bringen teilweise ganz bewusst falsche Dinge in Umlauf.
Geben Sie uns ein Beispiel?
Die SVP redet immer wieder davon, dass es um eine automatische Rechtsübernahme gehe. Das stimmt rechtlich nicht. Es gibt keine Automatismen. Verändert sich europäisches Recht und soll in eines unserer Abkommen übernommen werden, entscheidet der für das Abkommen zuständige Gemischte Ausschuss darüber. Dort müssen beide Parteien zustimmen. Wir sprechen von einem dynamischen und nicht einem automatischen System. Zum Vergleich: Die Schweiz ist mit Liechtenstein durch den Zollvertrag rechtlich stark verbunden. Dort gibt es Regelungen, die dazu führen, dass Liechtenstein automatisch übernimmt, was die Schweiz beschlossen hat. Andere Regelungen sehen vor, dass Streitfälle vom Schweizer Bundesgericht beurteilt werden müssen. Wir muten also Liechtenstein allerlei zu, was im umgekehrten Fall bei uns sehr kritisch diskutiert würde und was auch gar nicht auf dem Tisch liegt.
Stimmt es, dass die EU der Schweiz Bussen auferlegen könnte?
Bussen gibt es nur EU-intern, wenn sich ein Mitgliedsstaat nicht an geltendes Recht hält. Auch bei den Bilateralen III gibt es das nicht. Wer etwas anderes behauptet, irrt oder hält sich nicht an die Tatsachen.
Das Schweizer Stimmvolk hat sich in den vergangenen 25 Jahren in elf Abstimmungen für den bilateralen Weg entschieden. Hat die Schweiz gute Gründe, auch ein zwölftes Mal Ja zu sagen?
Der Bundesrat ist davon überzeugt, dass das ganze Paket grosse Vorteile für die Schweiz bringt und das Verhältnis zur EU stabilisiert wird. Die Schweiz folgt so einem Weg, den sie in den Fünfzigerjahren begonnen hat. Es braucht ein geregeltes Verhältnis mit der EU, unserer mit Abstand grössten Handelspartnerin. Nur so können wir vom erweiterten EU-Binnenmarkt profitieren. Obwohl man in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein kann, erachte ich den bilateralen Weg für sinnvoll.
Wie stark sind Volksrechte und der Föderalismus tangiert?
Jedes Abkommen hat Vorteile, aber auch Verpflichtungen. Das liegt in der Natur der Sache. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir uns ans Völkerrecht halten und damit auch an Abkommen, die wir schliessen. Es lässt sich nicht abstreiten, dass mit der dynamischen Rechtsübernahme und dem Streitbeilegungsverfahren gewisse Elemente enthalten sind, die bei künftigen Abstimmungen berücksichtigt werden müssen. Deswegen sind die Volksrechte aber meines Erachtens nicht derart eingeschränkt, dass die Bilateralen III inakzeptabel wären. Es geht darum, was am besten für unser Land ist. So betrachtet, kann man mit den Bilateralen III leben. Der EWR hat deutlich strengere Regeln.
Ist es rechtskonform, dass der Entscheid über die Bilateralen III laut Bundesrat ohne Ständemehr erfolgen soll?
Gemäss der Bundesverfassung benötigt der Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft wie der EU das obligatorische Staatsvertragsreferendum mit dem doppelten Mehr. Mit bilateralen Verträgen ist dies sowohl formal als auch inhaltlich nicht der Fall. Letztlich entscheidet das Parlament über die Art des Referendums. Es hat sich in der Vergangenheit aufgrund anderer Kriterien, die nicht in der Verfassung stehen, in gewissen Fällen für ein doppeltes Mehr ausgesprochen. Ich plädiere dafür, sich an die Verfassung zu halten. Dafür haben wir sie schliesslich. Demokratie ist das Volksmehr. Das Ständemehr dient dagegen dem Schutz der Kantone.
Hier geht es zur Tribune «Die Bilateralen III auf der Zielgeraden»
Christa Tobler ist ordentliche Professorin für das Recht der Europäischen Integration am Europainstitut der Universität Basel sowie Professorin für Europarecht an der Universität Leiden (NL). Sie ist Mitbegründerin des «EU Law in Charts Project», das zum besseren Verständnis des EU-Rechts beitragen will.